Rezension
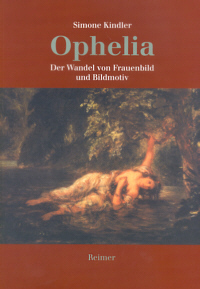
Die Kunsthistorikerin Simone Kindler intendiert in ihrer 2002 als Dissertation eingereichten und approbierten Studie nichts weniger als die Nachzeichnung der "Entstehungsgeschichte eines der populärsten Bildmotive der Kunstgeschichte" (213), jenes der Ophelia respektive des Sterbens der Ophelia. Die Autorin nimmt sich damit eines in der Tat sehr spannenden und aufschlussreichen Motivs an, das - ähnlich wie die Figur des Gretchens, Mignons, später Judiths und Salomes - in besonderer Weise dazu geeignet scheint, "Männerfantasien" zu entzünden und zum Ziel genderspezifischer Projektionen zu werden. Methodisch und fachspezifisch greift Simone Kindler dabei weit über die Grenzen der Kunstgeschichte im engeren Sinn hinaus. Sie integriert neben den ausdrücklich kunsthistorischen Zugängen auch literaturkritische, philologische, kultur- und theatergeschichtliche, mentalitätsgeschichtliche und feministische Fragestellungen. Dass ihr dabei manchmal der rote Faden aus den Händen zu gleiten und man als Leserin den Wald vor lauter Bäumen aus dem Blick zu verlieren droht, ist verständlich, wird aber nie zum Ärgernis.
In drei Kapiteln wird die Etablierung des bis heute geläufigen Ophelia-Motivs skizziert. In einem ersten, dem Shakespeare-Stück gewidmeten und deswegen vor allem literaturwissenschaftlich ausgerichteten Kapitel wird der Frage nachgegangen, wie Shakespeare selbst seine Ophelia zeichnet und präsentiert. Dabei stellt sich, so Kindler, nicht nur heraus, dass Shakespeares Ophelia über weite Strecken allein durch den männlichen, von außen auf sie gerichteten Blick bestimmt wird, sondern auch, dass bereits die Shakespeare'sche Ophelia durch eine Reihe von Ambivalenzen gekennzeichnet ist, die sie als "Hohlform" prädestinieren. Diese Rede von der von Shakespeare vorgegebenen "Hohlform" Ophelia zieht sich durch den ganzen Band, in ihr sieht Kindler wohl zu Recht einen der wichtigsten Gründe dafür, dass Ophelia überhaupt zu einer dermaßen populären Projektionsfigur werden konnte.
Im einem zweiten Kapitel, das sich insbesondere mit der Rezeption der Ophelia-Figur im 18. Jahrhundert beschäftigt, entwirft Kindler ein breites Panorama der Kunst-, Literatur- und Theatertheorie der prärevolutionären Epoche, die durch die herrschende Tabuisierung des Wahnsinns einerseits und durch die starke Polarisierung von Modellen weiblicher und männlicher Identitätsbildung andererseits eine radikale Umdeutung der Figur der Ophelia vornahm. Zudem wurden sowohl durch die im 18. Jahrhundert nach wie vor sehr starke Moralisierung des Frauenbilds als auch durch das noch herrschende Übergewicht des klassischen Regelkanons Shakespeares Stücke massiven Eingriffen unterzogen, die im Falle des "Hamlet" eine Reduzierung und Zurechtstutzung der Figur der Ophelia bedeuteten. So passte sich etwa die erste vollständige Übersetzung des "Hamlet" ins Französische durch La Place (1745/46) stark dem zeitgenössischen, aufklärerischen und neoklassizistischen Publikumsgeschmack an und machte nicht nur aus Hamlet einen noblen, durchsetzungsstarken Prinzen, sondern auch aus Ophelia eine tugendhafte, edle "Prinzessin". Aber auch die erste Bühnenbearbeitung "Hamlets" in Frankreich durch Ducis (1769) führte die moralischen und ästhetischen Bedenken weiter; hier überlebte Ophelia, "eine glückliche Verbindung und ein unbelastetes Regieren mit Hamlet" (138 f) schienen möglich. Ophelia wurde also zu einer sanften, sittlich-tugendhaften Frauengestalt uminterpretiert, alle Widersprüche in ihrem Charakter und vor allem ihr Wahnsinn wurden gestrichen. Aufführungen, Theateradaptationen und -illustrationen des 18. Jahrhunderts perpetuierten die Vereinfachung der Figur der Ophelia zu einem Bild "idealer" Weiblichkeit, deren Ambivalenzen, deren Wahnsinn und gewaltsamer Tod ausgespart blieben.
Allein eine Zeichnung des Schweizer Malers und Kunstschriftstellers Johann Heinrich Füßli "Ophelias Tod" (1770-1778) bildet die Ausnahme. Gleichzeitig markiert diese Zeichnung bereits so etwas wie einen Wendepunkt in der Entwicklung des Ophelia-Motivs, insofern hier zum ersten Mal das Sterben Ophelias in den Mittelpunkt gerückt wird und die Figur der Ophelia damit in die Assoziationsreihen von Wahnsinn, Wasser und Tod gestellt ist, die auch für die weitere Ausgestaltung des Ophelia-Motivs bestimmend bleiben werden. Vor allem ab den 20er-Jahren des 19. Jahrhunderts setzt eine Neubewertung der Figur der Ophelia ein, die sich zum einen dem gewandelten Zeitgeist, den Ideen der Romantik, und zum anderen dem durchschlagenden Erfolg der englischen Schauspieler in Paris verdankt. Insbesondere die Darstellerin der Ophelia, Harriet Smithson (die spätere Frau Hector Berlioz'), fasziniert das Pariser Publikum - darunter zahlreiche Künstler - durch ihr pathetisches Miterleben und Mitleiden. Eugène Delacroix wird sich zwischen 1838 und 1853 in vielfältiger Weise mit der Figur der Ophelia auseinandersetzen und in der Fokussierung auf ihren Tod ein Motiv festschreiben, das sich in den folgenden Jahrzehnten beinahe inflationär ausbreiten wird. In der Konnotation von Frau, Wahnsinn, Wasser, Tod werden Vorstellungen von Weiblichkeit transportiert, die diese in erster Linie mit Emotionalität, Passivität und Natürlichkeit gleichsetzen. "In den Ophelia-Bildern wird also der weibliche Körper über die Zusammenfassung Frau-Wasser, weinende Frau-melancholisch fließendes Wasser, Subjektauflösung-idealisierte Natur zur Projektionsfläche eines zeitenthobenen, eines unberührten Naturzustands." (84) Interessant ist der Hinweis Kindlers, dass Delacroix in der Zeichnung der Ophelia auch auf Elemente einer christlichen Märtyrer-Ikonografie zurückgreift und damit die Vorstellung eines pathetisch-leidenden Weiblichen zementiert - wenngleich die Folgerung, in der "Naturwerdung" Ophelias zeichne sich eine "Überwindung irdischen Daseins und die Aussicht auf ein gewandeltes, wenn auch als typisch weiblich stilisiertes Weiterleben [ab]" (200), zu gewagt erscheint.
In Summe bietet Simone Kindlers Buch ein sehr differenziertes Bild der Entstehung des Ophelia-Motivs in der Malerei des 19. Jahrhunderts, wobei die Disparatheit der Methoden und theoretischen Grundlegungen manchmal ein wenig störend, dann aber doch wieder sehr anregend wirkt. Vereinzelt sind stilistische und sprachliche Ungenauigkeiten und Unzulänglichkeiten festzustellen, die sich aber wohl bei der heute üblichen Lektoratspraxis (oder Nicht-Praxis) kaum vermeiden lassen. Bedauerlicher scheint hingegen die Tatsache, dass dem Weiterwirken des durch Delacroix eingerichteten und etablierten Bildmotivs der sterbenden Ophelia etwa bei den Präraffaeliten und Symbolisten zu wenig Raum gewährt wird, dass die großartigen Bilder von Redgrave, Millais, Redon und anderen auf wenigen Seiten abgehandelt werden. Gerade die Divergenz der Ophelia-Bilder und der daran geknüpften Weiblichkeitskonstruktionen wäre kunst-, mentalitäts- und gendergeschichtlich von größtem Interesse. Aber dieses Manko kann ja auch als Versprechen für einen weiterführenden Band genommen werden.
zurück zu KUNSTFORM 7 (2006), Nr. 3